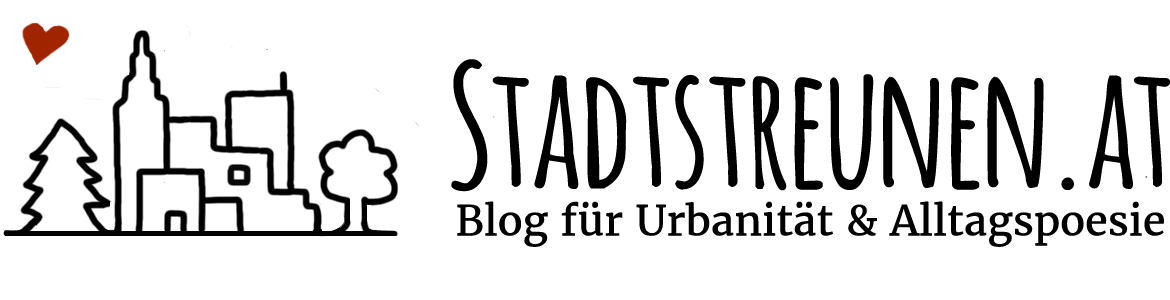Am 6. Dezember 2011 ist meine Oma – die Mutter meines Vaters – verstorben. Den zehnten Jahrestag ihres Todes möchte ich zum Anlass nehmen, um über die Trauer in meinem Leben nachzudenken. Der Zeitpunkt könnte passender nicht sein: Täglich sterben Menschen an einem verfluchten Virus, die Medienberichte sind ein einziges „Memento Mori“. Wer sich noch nie mit der Kapazität der österreichischen Krankenhäuser auseinandergesetzt hat, kommt derzeit fast nicht daran vorbei. Tod und Krankheit sind als gesellschaftliche Themen so präsent wie noch nie in meinem Leben. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich nicht schon vorher damit in Berührung gekommen wäre.

Das erste Begräbnis, auf dem ich je war, war das meiner Urgroßmutter (der Mutter der Mutter meines Vaters) im Jahr 1996. Ich war acht oder neun Jahre alt. An diesem Tag ging ich am Vormittag festlich in Tracht gekleidet in meine Wiener Volksschule, damit ich gleich nach dem Unterricht mit meinen Eltern nach Salzburg zum Begräbnis fahren konnte. Mein Großvater hielt vor dem Sarg, der von riesigen Blumenbouquets umgeben war, eine Trauerrede, gegen deren Ende er in Tränen ausbrach. Ich beobachtete verwundert die Szene. Seit wann konnte mein Großvater weinen? Warum waren die Menschen alle in Schwarz gekleidet? Woher kamen die vielen Blumen? Ich war wohl ganz still vor lauter Fragen. Früher hatten wir auf dem Weg nach Saalfelden oft einen Zwischenstopp in Salzburg eingelegt, um uns mit meiner „Urli-Oma“ in dem prächtigen Marmorsaal am Hauptbahnhof zu treffen. Ich durfte jedes Mal Palatschinken mit Marillenmarmelade bestellen und war beeindruckt von den kitschigen Engeln, die an der Wand angebracht waren. Nach dem Tod meiner Urgroßmutter war es damit vorbei, ein erster, feiner Einschnitt in meinem Leben.

Als meine Oma im Jahr 2011 starb, war ich schon erwachsen. Ihr Tod traf mich nicht unvorbereitet: Schon etliche Jahre davor hatte sie einen Schlaganfall erlitten und hatte seitdem ihre Tage in dem gemütlichen Seniorenhaus in Saalfelden verbracht, wo sie stets zufrieden und fröhlich wirkte. Sie wollte unbedingt 90 Jahre alt werden. Ihr Hausarzt, der sie jahrzehntelang gesundheitlich betreut hatte, gab ihr dieses Versprechen: „Frau Wohlfarter, das schaffen Sie!“ Tatsächlich konnte sie ihren 90. Geburtstag im September 2011 noch in kleiner Runde feiern. Kurz danach begannen ihre Lebenskräfte nachzulassen, nur drei Monate später war sie tot.

Ich kann mich noch erinnern, dass rund um ihr Begräbnis eine beinahe ausgelassene Stimmung in der Familie herrschte. Ihr Tod war irgendwie erleichternd, wir wussten, sie hatte gut mit ihrem Leben abschließen können und es sanft „hinüber“ geschafft. Ich weiß nicht, ob ich je wirklich traurig war. Es schien mir völlig normal, dass Großeltern eines Tages sterben, so war eben der Lauf des Lebens, dachte ich. Meine Oma hatte ein schönes Alter erreicht und war ganz gelöst von uns gegangen, ich behielt sie in lieber Erinnerung. Ich habe einiges von ihr angenommen: ihre Genauigkeit, ihren Ordnungssinn, ihr Wohlwollen, ihre Geduld. Erst viele Jahre später dämmerte mir, dass ich auch anderes, weniger Angenehmes von ihr mitbekommen hatte.

Ganz anders erging es mir mit dem Tod meines Vaters im Juni 2018. Ich wollte bis zuletzt nicht wahrhaben, dass mein geliebter Papi im Sterbebett lag, dachte immer noch, mit 70 Jahren könne man doch nicht einfach so sterben. Erst einen Tag vor seinem Tod klärte mich seine Ärztin auf, dass er gegen den Krebs chancenlos war, der sich längst im ganzen Körper ausgebreitet hatte. Seinen toten Körper zu sehen war grausam. Die blasse, gelbliche Gestalt, schwer gezeichnet von der Krankheit, hatte mit meinem lebensfrohen Vater kaum noch etwas zu tun. Wenige Tage vor seinem Tod entstand ein letztes gemeinsames Foto mit ihm, mir und meiner besten Freundin. Über drei Jahre lang habe ich gebraucht, bis ich dieses Foto überhaupt anschauen konnte. Sein Tod stellte eine echte Zäsur in meinem Leben dar. Seitdem gibt es ein „Davor“ und ein „Danach“, und das Danach ist in allem geprägt von diesem Verlust. Alles, was ich die letzten dreieinhalb Jahre erlebt habe, ist davon eingefärbt, manchmal mehr, manchmal weniger. Die Erlebnisse während seiner letzten Tage auf der Palliativstation im Salzburger Landeskrankenhaus haben sich mir so tief eingebrannt, dass ich lange in Träumen und in plötzlich auftauchenden Bildern davon verfolgt wurde. Ich sehe alles so deutlich vor mir, als wäre es gestern passiert, immer noch.

Zu den traurigsten und schwierigsten Aufgaben meines Lebens gehörte es, noch am selben Tag meinen Opa über den Tod seines Sohnes zu informieren. Er überlebte ihn um mehr als zweieinhalb Jahre. Im Februar 2021 durfte er, wenige Wochen vor seinem 98. Geburtstag, endlich von dieser Welt gehen, was er sich schon lange gewünscht hatte. „Ich möchte für immer einschlafen“, hatte er mir wieder und wieder gesagt, wenn ich ihn im Pflegeheim besuchte. Ihn als Toten zu sehen, mit gelben Tulpen zwischen den uralten, faltigen Händen, war für mich nicht schrecklich, sondern auf eine seltsame Art beruhigend. Ich hatte einen jahrelangen Prozess des Verabschiedens hinter mir und war mir seiner Verbundenheit sicher, ob nun in diesem Leben oder jenseits davon.

Nicht nur ist jeder Todesfall anders, auch jedes Begräbnis. Sowohl mein Vater als auch mein Großvater wurden im Familiengrab in Saalfelden bestattet. Beim Begräbnis meines Vaters im Juli 2018 kamen an die hundert Menschen, die teils lange Fahrten auf sich nahmen. Unsere Wiener Nachbarinnen waren begeistert von Saalfelden: „Wie konnte er uns nur sein Leben lang verschweigen, dass er im Paradies zuhause ist?“ Am Nachmittag ging in der Nähe ein Gewitter nieder. Ein Regenbogen war zu sehen, später am Abend eine Mondfinsternis, die den Mond rot einfärbte – ein würdiger, geradezu spektakulärer Abschied. Im Gegensatz dazu das Begräbnis meines Großvaters im März 2021: Aufgrund der Corona-Pandemie durften nur wenige Leute kommen, und ich erkannte viele gar nicht wegen der FFP2-Masken. Am Friedhof war es eisig kalt, und so fühlte es sich auch in meinem Herzen an.

Der Tod gehört zum Leben dazu, heißt es. Das bedeutet auch, dass zum Tod das Leben gehört: eine Sichtweise, die mich in den vergangenen Jahren immer wieder getröstet hat. Aus der Trauer kann Neues, Schönes, Lebendiges entstehen. Aber ein Menschenleben ist unwiederbringlich, jeder Trost kann den tiefen Schmerz darüber nur oberflächlich heilen. Eine uralte Erkenntnis, die jeder Mensch für sich neu machen muss – in der aktuellen Corona-Pandemie leider noch öfter als sonst.