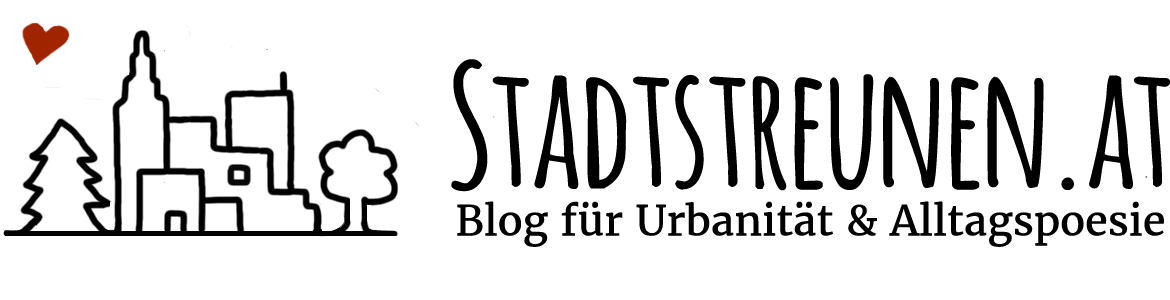Unlängst verbrachte ich einen strahlend schönen Septembertag in der Nationalbibliothek. Vom Lesesaal aus konnte ich sehen, wie sich die Sonne durch die Bäume des Burggartens brach. Ich war neidisch auf das beschauliche Leben da draußen, klemmte mich aber trotzdem hinter meine Arbeit. Dann kam die Mittagspause und zu meinem Entsetzen fand ich im Burggarten die dürren Blätter eines Ginkgobaums am Boden liegen, die mich an den nahenden Herbst erinnerten.

Ginkgoblätter im Burggarten
Es folgte ein schrecklicher innerer Kampf. Letztendlich siegte die vernünftigere Variante und das schlechte Gewissen musste klein beigeben. Zum Glück habe ich an solchen Tagen vorsichtshalber immer meine Badesachen mit! Um den Stadturlaub standesgemäß zu beginnen, holte ich mir erst mal ein Eis und schlenderte mit einem Streunergefährten gemächlich durch die Innenstadt. Wir gingen Richtung Schwedenplatz und überquerten bei der Urania den Donaukanal. Auf der Praterstraße schwang ich mich endlich auf mein Rad und trat voll in die Pedale. Über den Praterstern ging es weiter Richtung Reichsbrücke. Auf der Wagramer Straße fand ich inmitten der charakteristischen Bauten der UNO-City und nichtssagenden Hochhäusern die koptische Markuskirche, eine Kirche mit spezieller Geschichte.
Vom Bretteldorf zur koptischen Kirche
Die Markuskirche – eine von drei koptischen Kirchen in Wien – ist besser bekannt unter dem Namen Russenkirche. Der Name geht auf russische Kriegsgefangene zurück, die während des Ersten Weltkriegs in Baracken auf dem Areal lebten und zur Mitarbeit gezwungen wurden. Als 1917 der Bau der ursprünglich katholischen Kirche begonnen wurde, stand sie am Rande des sogenannten Bretteldorfes, einer illegalen Siedlung mit einfachen Behausungen und schlechter Infrastruktur. Gerne als „Elendsquartier“ oder „Slum von Kaisermühlen“ bezeichnet, wurde die Siedlung häufig überschwemmt und die nahe Mülldeponie sorgte zusätzlich für unzumutbare hygienische Zustände. Dennoch trug die bäuerliche Siedlung dazu bei, die Stadtbevölkerung während und nach dem Ersten Weltkrieg mit landwirtschaftlichen Produkten zu versorgen. In den 1920er Jahren kam es zu heftigen Auseinandersetzungen in dem sogenannten Bretteldorfer Krieg, als die Stadt Wien die wilde Bebauung des Areals in den Griff kriegen wollte. Immer wieder wurden Familien abgesiedelt, was aber durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde. Erst 1963 wurde die Siedlung endgültig geschliffen und es entstand der Donaupark – rechtzeitig für die Wiener Internationale Gartenschau im Jahr 1964.

Die koptische Markuskirche vor der UNO-City
Auf Fotos aus den 1950er Jahren ist das Viertel heute nur noch anhand der Markuskirche erkennbar, alles andere hat sich grundlegend verändert. Auch die Kirche selbst hieß ursprünglich eigentlich Christkönigskirche. Durch die neu errichtete UNO-City kamen ab den 1970er Jahren viele Menschen anderer Konfessionen nach Wien. Die Kirche wurde so adaptiert, dass auch evangelische und koptische Gottesdienste darin stattfinden konnten, und wurde später der wachsenden koptischen Gemeinde übergeben. Ein Relief mit dem gekreuzigten Jesus inmitten von Soldaten erinnert heute noch an ihre Entstehungsgeschichte.
Über das Stadtglück
Nach diesem kurzen Zwischenstopp überquerte ich die Alte Donau. Ein Warnschild mit der Aufschrift „Erholungsgebiet“ bereitete mich auf das vor, was nun kommen würde: ein kurzer Sprung in das mittelkalte Nass mit Ausblick auf den Wiener Versuch, eine Skyline zu haben.

Alte Donau mit Skyline
Zwischen dem Lesesaal in der Hofburg und dem Baden in der Alten Donau lag nicht mal eine Stunde! Ich dachte daran, wie sehr wir uns glücklich schätzen können, in Wien zu leben – noch dazu hat die Alte Donau eine sehr hohe Wasserqualität. Die Stadt Wien besitzt sogar zwei Mähboote, um das Algenwachstum einzudämmen. Eines davon konnte ich neben all den Segel- und Ruderbooten gerade in Aktion beobachten.
Danach überquerte ich am Birnersteig wieder die Alte Donau und fuhr am Angelibad vorbei, unter dessen Platanen ich schon in meiner Kindheit sorglose Stunden verbracht habe. Auf der Höhe des Bahnhofs Handelskai fuhr ich über den Hauptstrom der Donau und warf noch einen Blick zurück auf das süße Sommerleben in Transdanubien.

Abendliche Donaubrücken
Dann ging es einen meiner Lieblingsradwege entlang – quer durch die Gemeindebauten in Floridsdorf und bis zur Müllverbrennungsanlage in der Spittelau, wo ich links zum Donaukanal hin abbog. Der Radweg entlang des Kanals ist zwar etwas mühsam, weil man ihn mit zahlreichen mehr oder weniger verträumten Fußgänger*innen teilen muss, dafür gibt es aber immer viel zum Schauen – der Donaukanal mit seinen vielen Grafitti sieht jedes Mal ein bisschen anders aus. Dieser Vogel hatte es mir diesmal besonders angetan:

Kranich am Donaukanal
Um kurz vor 19 Uhr war ich wieder zurück bei der Nationalbibliothek – gerade rechtzeitig, um meine Sachen zu holen und die Prachtbauten der Hofburg im schönen Abendlicht erstrahlen zu sehen. Anschließend fuhr ich ein paar hundert Meter weiter und traf beim Museumsquartier meine Freundin Judith, um mit ihr gemeinsam das Lesefestival O-Töne zu besuchen, das sie auf ihrem Blog Leseloop ausführlich vorstellt. Ein guter Ausklang für einen überraschend guten Tag, finde ich!

Ein Löwe wacht vor der Hofburg
Literaturquellen
Die Informationen über die Markuskirche stammen von hier und hier.