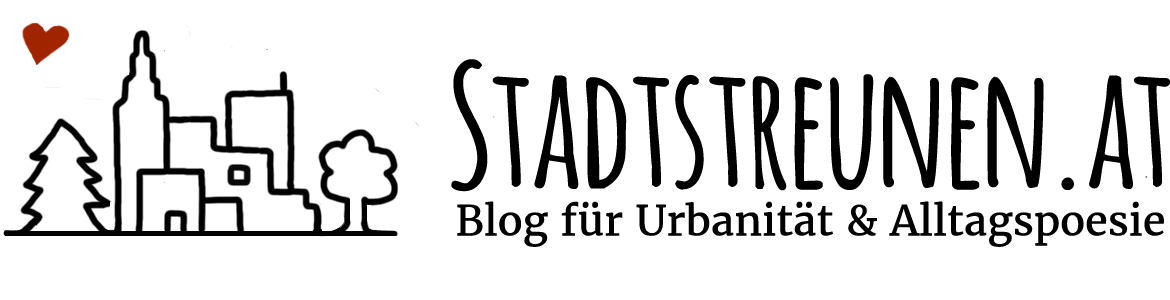Ich lebe in einer toten Stadt. Das kommt mir entgegen, wenn ich in mondlosen Nächten durch die verwaisten Straßen der Stadt ziehe, bekleidet mit dunklem Gewand und meiner schwarzen Haube, in die ich die widerspenstigen Haare hineinstopfe. So kann ich mit dem Dunkel der Nacht verschmelzen, ich schleiche hier- und dorthin und hinterlasse meine Botschaften an den abbröckelnden Wänden der Häuser.
Normalerweise bemerkt niemand meine nächtlichen Streifzüge, im dicht verbauten Gebiet habe ich oft das Gefühl, völlig einsam zu sein. Manchmal überkommt mich Angst, wenn ich im Zentrum dieser Stadt am weitflächigen Platz stehe und nur meinen eigenen Atem höre und das Zischen der Spraydose. Ab und zu höre ich aus der Weite ein Auto, meist ein Taxi, das mir auf der verlassenen Straße immer näher kommt, und ich ducke mich in dem Schatten, den ein dicht belaubter Kastanienbaum im flackernden Licht einer Straßenlaterne wirft. Ich kann den schwachen Duft der Kastanienblüten nur erahnen, die weißen Kerzen leuchten und erhellen die Nacht ein wenig.
Kurze Zeit später sitze ich auf einem ziegelroten Dach und beobachte, wie sich im Osten langsam die Dämmerung durchsetzt und es immer heller wird. Über mir schwirrt und flattert allerhand Getier, doch ich lasse mich davon nicht beeindrucken und stehe auf. Mir schwindelt von all dem Zeug, das ich in der Nacht in einem verschwiegenen Kellerlokal konsumiert habe, doch darauf nehme ich keine Rücksicht. Ich stehe auf dem ziegelroten Dach, das sich steil gen Boden neigt, breite die Arme aus und sauge die Morgenluft ein, ich nehme den blassblauen Himmel des Ostens in mir auf, knie mich nieder und sprühe meine Überzeugungen in grüner Farbe auf das Dach. Am nächsten Morgen werden sich die Spießbürger dieser Stadt entsetzlich darüber aufregen, denke ich mir und stelle mir ihre Gesichter vor. Diese Vorstellung bringt mich zum Lachen, ich lache immer lauter, doch niemand hört mich. Denn diese Stadt schläft nicht, diese Stadt ist tot.
In meinem Kopf spielen sich irre Gedankenspiele ab, die mich irgendwie erschrecken, doch gleichzeitig will ich mehr und mehr davon. In meiner weiten Tasche suche ich fahrig den Tabak, rolle mir eine Zigarette und streue ein paar grüne Brösel hinein. Es schaut schön aus, wie ich rauche: auf dem Dach, hinter mir die dunkle Nacht, die gerade weicht, vor mir der lichterfüllte Morgen, und ich dazwischen und blase grau-durchsichtige Rauchsäulen in den undefinierbaren Himmel.
Als es heller wird, verkrieche ich mich im Dachboden des Hauses, ich weiß genau, er steht seit Jahren leer. Nur einige Ratten und Fledermäuse leisten mir Gesellschaft, als ich mich auf den hölzernen Boden niederlasse und in die Luft schaue. Dabei beobachte ich interessiert, wie der Staub durch die Luft wirbelt und lange braucht, um sich beruhigt wieder auf den Boden fallen zu lassen. Die ersten Sonnenstrahlen fallen durch das Dachfenster herein und tauchen ein paar wenige Gegenstände, die kaputt und hoffnungslos an der Wand lehnen, in ein tröstliches Licht. Vor meinen Augen verschwimmt alles, ich lege mich auf den harten Boden, wo ich mich geborgen und glücklich fühlen kann, ich habe kein Bedürfnis nach einer wärmenden Wolldecke, die Sonnenstrahlen reichen mir.
Die Zeit ist formlos, sie dringt in mich ein, braust mir in den Ohren, doch sie spielt keine Rolle mehr in meinem gedankenlosen und visionenerfüllten Bewusstsein; irgendwann falle ich in einen tiefen, dunklen Schlaf. Blasen steigen in meinem Kopf auf und verursachen seltsame Träume und Einbildungen, die so wirklichkeitsgetreu sind, dass ich im Schlaf erschrecke, weil ich sie für Realität halte.
Und so reißt es mich plötzlich, ich fahre hoch und mir wird schwarz vor den Augen. Schwindlig stehe ich auf, doch mein benebeltes Gehirn findet kaum den Weg zum Dachfenster, mit Mühe kann ich die Augen öffnen, blicke hinaus und werde augenblicklich geblendet. Eine Weile stehe ich blind da und halte mich am Fensterrahmen fest. Endlich gelingt es mir, erst ein Auge, dann auch das andere aufzumachen, ich gewöhne mich langsam an den unerklärlich hellen Schimmer, der von draußen in den Dachboden herein strömt. Mit einem Ruck hebe ich meinen Körper auf das Fensterbrett und stemme mich hinaus.
Erst dann, als mein Blick von den Dachziegeln zu den Hügeln und Bergen der Umgebung schweift, realisiere ich, was passiert ist: Das ganze Land ist mit einer dicken Goldschicht überzogen und glitzert und funkelt unwiderstehlich in der frühen Sonne. Da, am Horizont, der große, pyramidenförmige Berg, er erscheint nicht mehr graublau im Gegenlicht, sondern ist vergoldet, samt Gipfelkreuz und Gämsenpopulation. Im Westen der See, der bei starkem Wind dunkelblaue, wütende Wellen schlägt und sonst in seiner Türkisheit an irgendein längst verlorenes Paradies erinnert (wäre das Ufer nicht so stark verbaut), er ist golden geworden. Die vielen Kirchtürme der Stadt, mit Patina überzogen, haben Farbe gewechselt: alles gold! Ich strauchle und schwanke, ich bin nahe dran zu glauben, dass ich den Verstand verloren habe. Dieses Land ist über Nacht golden geworden!
Aus meinem Inneren dringt ein Schrei an die Oberfläche, doch er bleibt mir im Hals stecken, ich gerate in Panik, stolpere über einen widerspenstig aufragenden Dachziegel, kann mich nur mit Mühe an der Dachrinne festhalten. Ich wage einen Blick auf die Straßen, statt dem üblichen einfallslosen Beton strahlt mir Gold entgegen, einige morgendliche Passanten stehen da, mit dem Einkaufskorb unter dem Arm, auch sie wurden von dem verführerisch leuchtenden Stoff eingehüllt, bewegungsunfähig gemacht. Der Fluss ist golden, das Wasser steht still, die Fische schicken hilflose Blubberblasen an die Oberfläche, bevor auch sie zu leblosen Wesen erstarren. Die Autos sind mitten auf der Straße stecken geblieben, einige Menschen wurden genau dann mit Gold überzogen, als sie versuchten, aus dem Auto auszusteigen. Sie verrenken sich in seltsam anmutenden Posen zwischen Auto und Straße, können weder vor noch zurück, sind genau so starr wie alles andere in dieser goldenen Stadt.
Kein Windzug bewegt die Blätter der Bäume, die Fahnen, die stolzen, flattern nicht mehr im Wind, kein Kind schreit nach Eis, die Vögel sind vom Himmel gefallen. Es muss sich um einen grauenhaften Traum handeln, denke ich mir, es kann, es darf nicht wahr sein! Ich bin kurz davor, diesem Wahnsinn zu verfallen, und so wie die anderen starr und geblendet zu werden.
Doch dann reißt mich etwas zurück, mit schlafwandlerischer Sicherheit klettere ich zurück in den Dachboden, wo in einer Ecke meine Spraydose steht. Obwohl meine Sinne geblendet sind, weiß ich, was ich zu tun habe, ich nehme die Dose, steige zurück auf die goldenen Ziegeln des Daches und beginne, mit riesigen Buchstaben eine Botschaft auf das Dach zu malen, so groß, dass sie weithin zu sehen ist, ich möchte sicher gehen, dass sie alle sehen können, auch jene, die für diesen Goldwahn verantwortlich sind. Und ich weiß, wer dafür verantwortlich ist, ich kann die Namen einzeln nennen. Jeden einzelnen!
Langsam nimmt mein Spruch Form an, ich blicke zufrieden auf meinen Schriftzug: „Mit mir nicht!“ Darunter mein Markenzeichen, der schnell skizzierte Kaktus mit langen Stacheln und der überdimensionierten Blüte auf einer Seite. Ich gehorche euch nicht, möchte ich damit sagen, ich bin nicht eine von euch, ich nicht! Nein! Mit mir könnt ihr nicht dieses Spielchen spielen, ich bin immun gegen eure Strahlungskraft, gegen euer Gold! Ich lasse mich nicht täuschen und für dumm verkaufen!
Ich schreie all das heraus, was sich in vielen Jahren in mir angestaut hat, wie Gift würge ich es aus mir heraus, stehe da und muss es endlich loswerden. Irgendwann bin ich so erschöpft, dass die Welt nicht mehr golden aussieht, sondern erst violett, dann schwarz wird. Ich gleite hinüber in bildlosen Schlaf, der dunkel ist wie ein dichter Wald in einer stark bewölkten Nacht. Mehrere Stunden verbringe ich in einem angenehmen Zustand der Bewusstlosigkeit, spüre weder die Sonnenstrahlen auf meiner Wange noch die Ratte, die über mich klettert und sich an meiner Spraydose eine Kralle anstößt.
Als ich aufwache, bin ich voller Motivation. Heute werde ich für meine Ideale einstehen, heute werde ich voller Energie gegen die unüberwindbare Mauer kämpfen, die mich hier täglich aufs Neue umgibt, heute werde ich meine Visionen retten können und mich gegen das System aufbäumen! Heute ist der Tag!
Als ich schwungvoll aufstehe, fällt mir die Vorlesung ein, zu der ich doch gehen wollte. Ist das Kämpfen für Ideale nicht wichtiger als eine Vorlesung, frage ich mich. Doch mein gutes Gewissen gibt gleich contra: Auch der Besuch einer Vorlesung ist ein Versuch, die Welt zu retten! Doch zuallererst brauche ich einen Kaffee, um meine Gedanken zu ordnen und wieder zu mir zu kommen, mein Kopf fühlt sich an, als wäre er von einer dicken, wattigen Wolke umfangen.
Ich verlasse den Dachboden und schleiche mich unbemerkt aus dem Haus. Im Kaffeehaus gleich ums Eck gibt es den besten Kaffee der Stadt. Ich krame in meinen Hosentaschen, finde zuerst alles mögliche andere Zeug, eine abgelaufene Busfahrkarte, einen Kronkorken, eine Briefmarke aus dem letzten Urlaub, dann, endlich, das Geld. Ich halte den Becher mit der rauchenden, schwarzen Flüssigkeit in beiden Händen und genieße den Moment, als ich mir die Zunge verbrenne und von meinem verwirrten Zustand zurück finde zu klaren Gedanken. Dann betrete ich den Platz vor dem Café, er ist der Hauptplatz der Stadt, hier fahren alle Busse weg und mehrere Uhren verkünden, ob du willst oder nicht, die Uhrzeit.
Es ist 11.42 Uhr, kurz vor dreiviertel zwölf. Einmal mehr habe ich meine Vorlesung versäumt. Sie endet in genau zweieinhalb Minuten. Mit dem städtischen Bus fahre ich in meine Wohnung, die schon fast im Sumpf liegt, der den nahen, glitzernden See umgibt. Ich lege mich ins Bett und schlafe erneut ein. Auch heute wird es wohl nichts mehr mit dem Weltretten.
Über diesen Text
Dieser Text erschien vor langer, langer Zeit – im Jahr 2009 nämlich. Ja, die paar Jahre sind nicht so viel um, aber vom Gefühl her könnte der Text ebenso gut in einem anderen Leben entstanden sein. Damals gab es keinen Blog, der mich zum Schreiben animierte, stattdessen ein halbherziges Bakkalaureatsstudium an der Universität Klagenfurt/Celovec und ein umso leidenschaftlicheres Engagement für die Rechte sprachlicher Minderheiten. Und es gab den Zeit Campus Literaturwettbewerb mit dem Thema „Ein Grund, nicht in die Vorlesung zu gehen“. Diese Herausforderung nahm ich zum Anlass, die Erfahrungen in Kärnten/Koroška zu verarbeiten, und tatsächlich – unter 1121 Einsendungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum schaffte ich es unter die Auswahl der 21 besten Texte. Bis heute bin ich stolz darauf, aus dem vergifteten gesellschaftlichen Klima in Kärnten heraus ein Stück Literatur geschaffen zu haben.